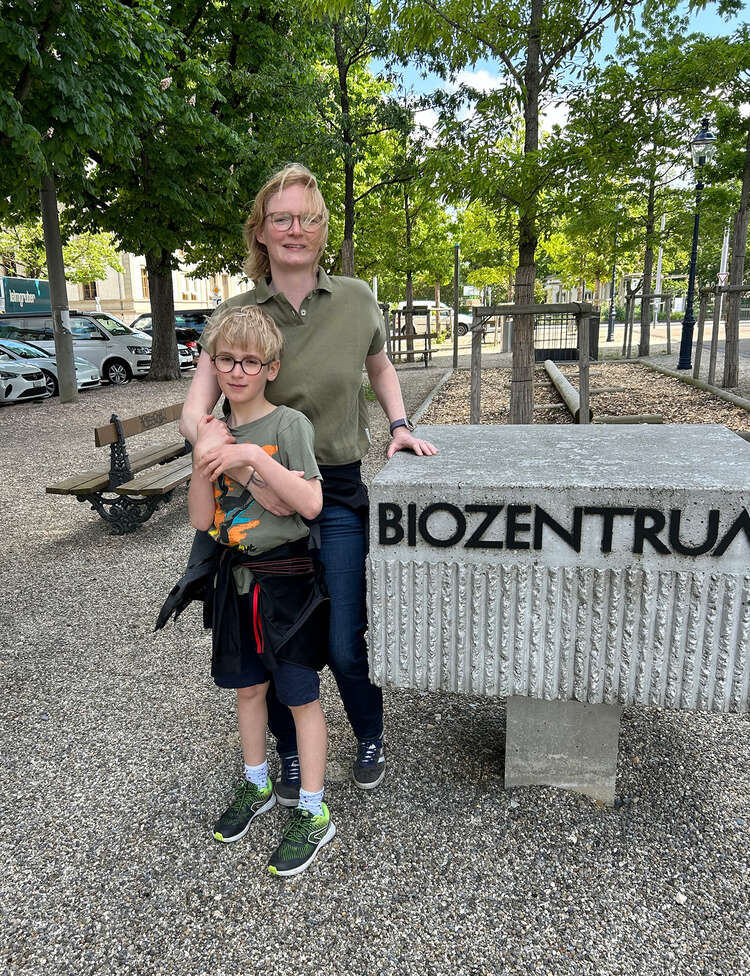Du hast Biochemie studiert und leitest jetzt eine Forschungsgruppe am Hubrecht Institut in Utrecht. Eine geradlinige Karriere. Wolltest du schon immer Forscherin werden?
Tatsächlich hatte ich mir das schon in meiner Schulzeit in den Kopf gesetzt, ohne eigentlich zu wissen, was Forschung genau bedeutet. Zum einen hatte ich eine tolle Biologielehrerin, zum anderen hatte mein Vater einen Hirntumor, seit ich neun Jahre alt war. Ich bin mit der Krebserkrankung quasi aufgewachsen. Seitdem ich verstanden hatte, was da passiert, wollte ich in die Krebsforschung.
Und, bist du schliesslich Krebsforscherin geworden?
Wenn man es genau nimmt, war ich nie wirklich in der Krebsforschung tätig, aber alle meine Forschungsstellen hatten im weiteren Sinne mit Krebs zu tun. Mir ging es mehr ums Verstehen, deshalb habe ich immer Grundlagenforschung gemacht. Darauf baut letztlich alles auf.

Ina Sonnen ist Forschungsgruppen-
leiterin am Hubrecht Institut in Utrecht, Niederlande. Sie studierte Biochemie an der Universität Jena und promovierte anschliessend bei Prof. Erich Nigg –zunächst am Max-Planck-Institut für Biochemie in München und ab 2009 am Biozentrum. Nach ihrem Postdoc am European Molecular Biology Laboratory (EMBL) in Heidelberg wechselte sie 2018 ans Hubrecht Institut. Sie hat eine Tochter und einen Sohn im Alter von 12 und 10 Jahren.
Woran forschst du denn derzeit?
Da muss ich ein wenig ausholen. Während meines Postdocs am EMBL in Heidelberg habe ich die Dynamik von Signalwegen untersucht. Früher dachte man, dass Signalwege entweder an- oder ausgeschaltet sind. Und dass auf diese Weise die Zellteilung und -differenzierung gesteuert wird. Mittlerweile wissen wir jedoch, dass Signalwege dynamisch sind.
Wie kann man sich das vorstellen?
Die Stärke von Signalen kann ansteigen oder abfallen. Signale können aber auch oszillieren, das heisst, es geht rauf und runter. Das ist wie bei einem old-fashion Radio. Dort werden Radiowellen mit AM (amplitude modulation) und FM (frequency modulation) verändert, um akustische Signale zu übertragen. Zellen können oszillierende Signale auslesen und damit auch Informationen weiterleiten. Wir wussten jedoch lange Zeit nicht, ob diese Oszillationen irgendetwas bewirken.
Und was habt ihr herausgefunden?
Als Postdoc habe ich ein Microfluidics System etabliert, mit dem wir die Oszillation von Signalen gezielt verändern können. Auf diese Weise konnten wir zeigen, dass sie bei der Embryonalentwicklung eine Rolle spielen. Als ich meine eigene Gruppe startete, wollten wir herausfinden, ob dies auch in anderen Geweben der Fall ist. Und tatsächlich konnten wir in Miniatur-Därmen, sogenannten Darm-Organoiden, solche Oszillationen nachweisen.
Welche Rückschlüsse konntet ihr daraus ziehen?
Wenn die Signale schnell oszillieren, dann bildet sich die eine bestimmte Zellart, wenn sie langsamer oszillieren, eine andere. Dieser Mechanismus ist eine ganz neue Art wie Zelldifferenzierung reguliert wird. Das war völlig unbekannt – zumindest im Darm. Wie kann es sein, dass bestimmt Frequenzen dies und eine andere etwas anderes bewirkt? Wie können die Zellen diese Signal-Oszillationen detektieren? Das sind die nächsten Fragen, denen wir nachgehen wollen.
Inwiefern hat dies mit Krebs zu tun?
Wir wissen jetzt, dass Signale auch im Darm dynamisch sind. Die Frage ist nun, was passiert mit der Dynamik, wenn es tumorauslösende Mutationen in den Signalwegen gibt, wie es bei Darmkrebs der Fall ist. Wir haben jetzt angefangen in Organoiden zu schauen, wie sich die Dynamik der Signale verändert, wenn wir solche Mutationen einfügen. Im nächsten Schritt wollen wir das auch in Patientenproben untersuchen.
Da schliesst sich also der Kreis?
Ja, deshalb finde ich es gerade perfekt. Wir machen immer noch Grundlagenforschung zur Embryonalentwicklung, und gleichzeitig kann ich jetzt auch noch Krebsforschung machen. Doch auch während meiner Promotion bei Erich Nigg zuerst am MPI in München und dann am Biozentrum gab es einen entfernten Link zu Krebs. Dort habe ich an Zellteilung gearbeitet. Und diese steht ja quasi zentral in der Krebsforschung.
Du bist mitten in deinem PhD mit Erich Niggs Gruppe von München nach Basel gezogen. Wie war das für dich?
Ich hatte keine Probleme damit. Wir sind mit einer Gruppe von sechs bis sieben Leuten nach Basel gegangen. Das schweisst zusammen. Wir hatten damals zwei Wohnungen direkt nebeneinander in der Nähe der Kaserne, beinahe im Rotlichtviertel. Doch das haben wir erst später herausgefunden. (lacht) Und erst letztens kam hier der Wickelfisch-Schwimmsack wieder zum Vorschein. Das hat viele schöne Erinnerungen wachgerufen – Rheinschwimmen inklusive.
Die hast du auch vor zwei Jahren am World Alumni Day aufleben lassen…
Ja, ich war beeindruckt zu sehen, wie viel sich verändert hat. Alles ist so modern. Als wir mit Erich Nigg 2009 ans Biozentrum kamen, drehte sich alles um die Planung des neuen Gebäudes. Erich hat sich viel mit den Architekten auseinandergesetzt. Es war spannend zu sehen, was verwirklicht wurde und was nicht. Ich habe mich auch gefreut, Alex Schmidt von der Proteomics und Oliver Biehlmaier von der Imaging Core Facility wiederzusehen. Die beiden haben zeitgleich mit uns im 2. Stock angefangen, denn der Aufbau der Core Facilities war Erich Niggs erste Amtshandlung.
Seit 2018 leitest du selbst ein Team. Wie war der Einstieg direkt nach dem Postdoc?
Das war ein Sprung ins kalte Wasser. Das Schwierige ist, dass man nur fürs Forschen ausgebildet ist. Man lernt allerdings nicht, wie man ein Team leitet, Grants schreibt oder sich um die Finanzen kümmert. Aber alle trauen es dir zu. Das erste Jahr war ganz schön happig. Ich dachte öfter mal, oh je, was muss ich jetzt machen.
Wo hast du Hilfe gefunden?
Wir, also alle frisch berufenen Tenure Track Gruppenleiter, haben ein Netzwerk aufgebaut. Wir haben uns einmal im Monat getroffen, um uns über unsere Probleme auszutauschen. Allein schon zu sehen, dass sich jeder mit ähnlichen Dingen beschäftigt, hat sehr geholfen. Mittlerweile sind meine sieben Jahre Tenure Track schon um. Vor ein paar Wochen habe ich meinen Tenure Record einreichen müssen. Und wie ich jetzt gerade erfahren habe, wurde ich zum Senior Group Leader befördert.
Hast du dich nach sieben Jahren auch privat gut eingelebt?
Mir hat es gleich gefallen, dass die Leute hier so entspannt und offen sind. Viele sprechen Englisch und Deutsch, das hat es gerade am Anfang leichter gemacht. Ich komme ursprünglich aus der Nähe von Dortmund, nahe der niederländischen Grenze. Dass wir uns gleich wohl gefühlt haben, liegt vermutlich auch an der ähnlichen Mentalität.
Und sprichst du auch Holländisch?
Sofort als wir hergezogen sind, habe ich einen Intensivkurs für Deutschsprachige absolviert. Nach vier Wochen hatte ich mein Examen in der Tasche. Das war aber nicht so schwer. (lacht) So richtig angefangen zu sprechen habe ich dann erst während Corona. Wir sassen alle zu Hause und haben mehr mit den Nachbarn geredet. Ich bin überzeugt, dass es immergut ist, die Landessprache zu beherrschen. Auch wenn bei der Arbeit Englisch gesprochen wird. Das Inoffizielle, das Networking läuft eher auf Holländisch ab. Meine Kinder haben die Sprache damals innerhalb von zwei Monaten gelernt.
Du bist damals also mit Kind und Kegel nach Utrecht aufgebrochen…
Ja, anfangs hatte es mich etwas gestresst, dass ich die gesamte Familie „gezwungen“ habe, nach Utrecht mitzukommen. Aber so ist das eben, wenn man in der Forschung tätig ist. Mein Mann hatte damals keinen Job, hat dann aber schnell eine Stelle als Arzt im Spital gefunden. Für mich war es wichtig, trotz Kindern weiterzuforschen. Das ist kein entweder oder, es geht definitiv beides. Aber man kann dann nicht beides perfekt machen. Und man braucht die richtige Unterstützung, zum Beispiel einen Partner, der einen voll unterstützt.

Ina Sonnen mit Familie in Utrecht.